Um zu zeigen, was im Kernland der deutschen Fleischproduktion auf dem Spiel steht, biegt der Biologe Ludger Frye mit seinem Geländewagen auf einen holprigen Waldweg ein und deutet kurze Zeit später links in ein großes Loch, in dem etwas Wasser steht. „Diese Sandgrube hier war vor einigen Jahren trockengefallen“, sagt Frye. „Der gesamte Amphibienbestand drohte damals auszusterben.“
„In den Mooren steht momentan noch das Wasser, aber sie drohen auszutrocknen.“
Lutz Neubauer
Auf dem Beifahrersitz sitzt Lutz Neubauer, Schnurrbart, runde Brille, Lederstiefel, kurbelt das Fenster runter und zeigt mit dem Finger in die Ferne. Am Horizont sieht man es schimmern. „In den Mooren steht momentan noch das Wasser, aber sie drohen auszutrocknen“, sagt Neubauer. Das wäre fatal für viele Tierarten – und auch für das Klima. Der Torf speichert große Mengen Kohlenstoff, solange er nass ist. Trocknet das Moor aus, wird er als CO2 freigesetzt.
Wir fahren durch die Wälder am Ortsrand des Städtchens Lohne, mitten im sogenannten Schweinegürtel Deutschlands, wo mehr Masttiere leben als Menschen. Hier in Niedersachsen liegt das Zentrum der deutschen Fleischindustrie.

Dann abonniere unser Magazin gleich jetzt – gedruckt und als PDF.
Der Grund für Fryes und Neubauers Sorge liegt keine fünf Minuten entfernt. Ein rot-graues Ungetüm ragt dort in die Höhe, auf dem platten Land ist es kilometerweit zu sehen. Hier schlachtet die Firma PHW täglich rund 180.000 Hühner, mehr als ein Zehntel der deutschen Produktion. Im Supermarkt wird das Fleisch von PHW beispielsweise als „Meister-Medaillons“, „Bruzzler“-Würstchen oder „Geflügel-Mortadella“ von Wiesenhof vermarktet.
Ludger Frye stellt das Auto in der Nähe des Werktors ab und zieht seine blaue Jacke mit der Aufschrift des Naturschutzverbands „Nabu“ an. Als Neubauer aussteigt, schaut er links und rechts nach dem Sicherheitsdienst. „Normalerweise kommen sie recht schnell“, sagt er. Dann beginnen die beiden zu erzählen.
Für Frye und Neubauer ist klar: Der Schlachtbetrieb ist eine Gefahr für die Region. PHW, fürchten sie, grabe dem Landkreis schrittweise das Wasser ab. Deshalb streiten sich Frye, Neubauer und ihre Mitstreiter seit Jahren mit dem Unternehmen. Der Landkreis Vechta, der für die Verteilung des Grundwassers zuständig ist, weist den Vorwurf zurück. PHW äußert sich auch auf mehrmalige Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht.
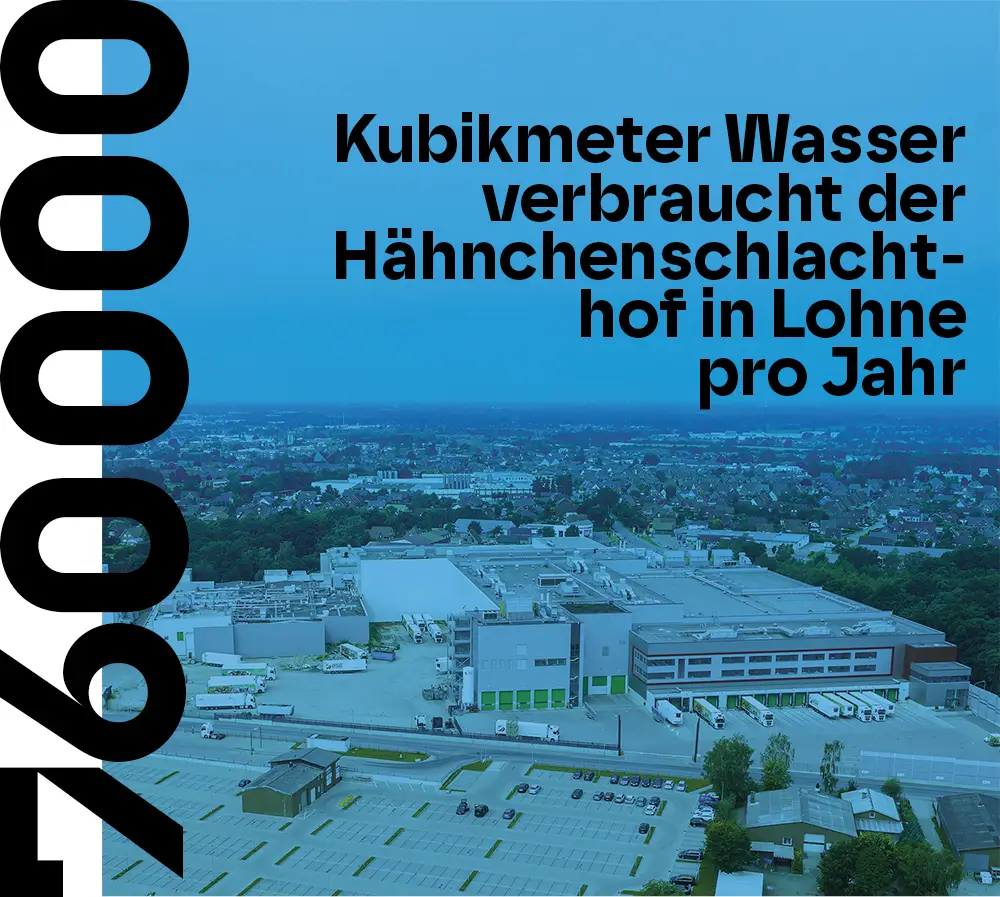
Giga-Schluckspecht: Im Wiesenhof-Schlachthof im niedersächsischen Lohne sterben jährlich 65 Millionen Masthühner
© picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
800.000 Kubikmeter Wasser darf der Schlachthof pro Jahr aus dem Grundwasser entnehmen, in den vergangenen Jahren hat er die erlaubte Menge nahezu ausgeschöpft. Frye und Neubauer sind der Ansicht, dass das zu viel ist, maximal 500.000 Kubikmeter sollten es sein. Der Nabu hat deshalb gegen den Landkreis Vechta geklagt, der die Wasserrechte vergibt – und in erster Instanz Recht bekommen. Doch der Landkreis ist in Berufung gegangen. Solange das Verfahren läuft, darf PHW weitermachen wie bisher.
Wofür Schlachtbetriebe solche Mengen Wasser brauchen? In fast jedem Produktionsschritt kommt es zum Einsatz: beim Brühen der Tiere, um die Borsten zu entfernen, beim Zersägen in zwei Teile, beim Zerteilen mit Messern. Die Werkzeuge werden nach jedem Kontakt mit einem Tierkörper gereinigt, um die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Jeder Lkw wird nach dem Entladen gründlich ausgespült. Die größten Schlachtbetriebe in Deutschland arbeiten rund um die Uhr: Sechzehn Stunden am Tag wird geschlachtet, die Nachtschicht macht acht Stunden lang alles sauber.
Der Biologe Ludger Frye ist nicht weit von Lohne aufgewachsen, er ist Nabu-Vorstand im Landkreis Vechta. „Die Natur hier ist total spannend“, sagt er. Durch den großen Moorgürtel sei die Artenvielfalt unheimlich hoch. „Aber all das ist durch die Übernutzung von Böden und Wasser hochgradig bedroht.“
Deutschland hat in den vergangenen zwanzig Jahren Wasser in der Dimension des Bodensees verloren – und ist damit eines der Länder mit dem größten Wasserverlust weltweit.
Viele Jahrzehnte lang gab es in Mitteleuropa scheinbar unbegrenzt Wasser. Doch das hat sich geändert. 2018 bis 2020 etwa herrschte eine beispiellose Dürre. Europas Gewässer und das Grundwasser seien unter Druck wie nie zuvor, warnte die Umweltagentur der EU im vergangenen Jahr. Laut dem kanadischen Water Security Institute ist die Lage bei uns besonders bedrohlich: Deutschland habe in den vergangenen zwanzig Jahren Wasser in der Dimension des Bodensees verloren – und ist damit eines der Länder mit dem größten Wasserverlust weltweit. Ein Grund dafür sei der Klimawandel. Ein anderer: Es werde offenbar mehr Grundwasser abgepumpt als in den Jahrzehnten zuvor.
Ein höherer Wasserverbrauch als beim Tesla-Werk
Mit den schwindenden Ressourcen werden auch die Verteilungsfragen akuter. Wer darf wie viel Wasser entnehmen? Und wofür? Die private Wassernutzung – für Toiletten, das Duschen, für Kochen und Abwaschen, Blumengießen oder Rasensprengen – macht in Deutschland weniger als ein Drittel des Gesamtverbrauchs aus. Einen weitaus größeren Anteil hat die Industrie, vor allem Fabriken, Bergbau und Kraftwerke.
Auch Schlachtbetriebe haben laut Umweltbundesamt „relativ hohe“ Wasserverbräuche. „Relativ hoch“, das ist relativ unkonkret. Wie viel Wasser Tönnies, PHW, Westfleisch, Rothkötter, Danish Crown oder Vion in ihren riesigen Schlachtanlagen tatsächlich verbrauchen, war bislang nur in Einzelfällen bekannt.
Erstmals hat deshalb atmo gemeinsam mit der Recherche- und Transparenzplattform FragDenStaat systematisch die Wasserverbräuche von insgesamt 45 industriellen Schlachtanlagen der zwölf größten Schlachtunternehmen in Deutschland erfragt. Wie viel Wasser verbrauchen sie? Und was zahlen die Unternehmen für ihr Wasser?
Die Zahlen, die wir auf diese Weise zutage fördern konnten, belegen: Industrielle Schlachtbetriebe sind große Wasserschlucker – und sie zahlen dafür manchmal viel geringere Preise als Privatleute. Mindestens zehn Milliarden Liter Wasser verbrauchen die Betriebe laut unserer Recherche pro Jahr insgesamt – das wäre so viel wie rund 220.000 Menschen. Die tatsächliche Menge liegt noch höher: Einige Behörden und Wasserversorger weigern sich auch nach monatelangen Briefwechseln, Auskunft über die Verbräuche zu geben.
Der PHW-Geflügelschlachthof in Lohne zum Beispiel saugt mehr Wasser aus dem Boden als die umstrittene Tesla-Gigafactory in Grünheide. Der riesige Tönnies-Schlachtbetrieb im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück verbraucht jährlich sogar fast viermal so viel Wasser wie das Tesla-Werk. Noch ist das Wasser dort nicht so knapp wie in Brandenburg. Doch auch in dieser Region ist es eine schwindende Ressource. Rund ein Viertel der 45 angefragten Betriebe liegt in oder um den sogenannten Schweinegürtel in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Eine kürzlich erschienene Studie des BUND zu Wasserknappheit zeigt: In vielen Landkreisen der Region, etwa in Vechta oder Cloppenburg, herrscht Wasserstress infolge von Übernutzung oder sinkenden Pegelständen. „Der Wasserverbrauch industrieller Schlachtbetriebe ist erheblich“, sagt Claudia Pahl-Wostl, Professorin für Ressourcenmanagement an der Universität Osnabrück. Besonders problematisch sei die räumliche Ballung der Schlachthöfe. „Da kann es regional durchaus zu Wassernutzungskonflikten kommen.“
FragDenStaat klagt auf Wasserauskunft
In Lohne stehen Ludger Frye und Lutz Neubauer in einem Wäldchen vor einer unscheinbaren Betonplatte, die in den Boden gelassen ist. Hier, sagt Neubauer, fördere PHW das Grundwasser, das dem Moor bald fehlen könnte. Die Brunnen sind der Grund für ihre Klage gegen den Landkreis. Doch ob das wirklich so ist – Schlachthofdurst legt Moore trocken – können Neubauer und Frye nicht mit Sicherheit belegen. Denn Grundwassersysteme sind komplex. Regenfälle und Dürren spielen eine Rolle, die Beschaffenheit des Bodens, die Versiegelung von Flächen und auch die Entnahmemengen von industriellen Großverbrauchern – wie eben auch Schlachthöfen. Beweisen lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen den Praktiken der Fleischindustrie und dem Fallen der Grundwasserpegel kaum. Der Landkreis Vechta bestreitet, dass es einen Zusammenhang gibt und beruft sich auf Gutachten, die der Schlachtbetrieb jedes Jahr einreichen muss: „Durch die Grundwasserentnahme bedingte Auswirkungen auf das nahe gelegene Moor sind derzeit nicht zu befürchten“, schreibt ein Sprecher. PHW hat unsere Fragen bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.
Und so sammeln Neubauer, Frye und ihre Mitstreitenden beim Nabu selbst Belege, um ihre Vermutung zu untermauern. Früher ist Neubauer mit dem Maßband losgezogen und hat die Pegelstände an den öffentlichen Brunnen der Region eigenhändig gemessen. Heute hat er Zugriff auf die offiziellen Messdaten. An rund der Hälfte der 62 Messstellen sind die Pegel laut seinen Aufzeichnungen in den vergangenen zwanzig Jahren stark gesunken. Neubauer ist Arzt im Ruhestand, über die Jahre hat er sich in die Geohydrologie der Region eingearbeitet. „Es ist schwer zu beweisen: Was ist Grundwasserentnahme, was ist Klimawandel, was ist Bodenversiegelung?“, sagt er. „Aber wenn Sie Baustein für Baustein zusammentragen, können Sie schon eine gewisse Sicherheit erlangen.“
Unsere Recherche hat einen möglichen Grund dafür zutage gefördert, weshalb die Fleischindustrie sich beim Wasserverbrauch nicht besonders sparsam zeigt: Wasser ist für Schlachtbetriebe oft besonders günstig. In mindestens fünf Fällen haben Wasserversorger Sonderverträge mit Schlachtbetrieben geschlossen – über die vereinbarten Preise schweigen sie. Knapp die Hälfte aller Schlachtbetriebe fördert Wasser zudem über eigene Brunnen, zum Teil erhebliche Mengen wie etwa PHW in Lohne. Für diese Förderung bezahlen sie häufig nur wenige Cent pro Kubikmeter Wasser. In Bayern, Hessen oder Thüringen zahlen Brunnenbesitzer aktuell sogar überhaupt keine Abgaben. Die Preise legen die Bundesländer fest.
Die Firma PHW zahlt rund fünf Cent pro Kubikmeter gefördertem Wasser aus eigenen Brunnen, insgesamt um die 35.000 Euro pro Jahr. Das Wasser muss sie in eigenen Anlagen aufbereiten, wodurch weitere Kosten entstehen; auch über deren Höhe schweigt PHW. Zum Vergleich: Die Bürgerinnen und Bürger in der Region beziehen ihr Trinkwasser vom Wasserverband OOWV – für 1,56 Euro pro Kubikmeter.
„In Zeiten knapper Ressourcen ist der Preis ein wichtiges Steuerungsinstrument“, sagt die Professorin Claudia Pahl-Wostl. „Daher kann ich niedrige Preise für Großverbraucher aus Sicht des Ressourcenschutzes nicht befürworten.“
„Behörden braten der Fleischindustrie eine Extrawurst, wenn sie die Daten nicht offenlegen. Lebensmittel Nummer eins ist Wasser – und nicht Schweinefleisch.“
Reinhild Benning, DUH
Doch Behörden und Wasserversorger gewähren der Fleischindustrie nicht nur günstige Preise – sie mauern auch, wenn es um Auskunft geht. Für rund ein Drittel der Betriebe haben sie auch nach monatelangen Briefwechseln keine vollständigen Daten geschickt. Reinhild Benning, politische Leiterin für Landnutzung bei der Deutschen Umwelthilfe, hat dafür kein Verständnis: „Behörden braten der Fleischindustrie eine Extrawurst, wenn sie die Daten nicht offenlegen. Lebensmittel Nummer eins ist Wasser – und nicht Schweinefleisch.“
Weil die Öffentlichkeit ein Recht hat zu erfahren, wie hoch die Verbräuche sind, klagen die Autoren mit FragDenStaat gegen den Wasserverband OOWV auf Auskunft. Denn die Verteilungsfragen rund um unser Wasser werden zunehmen. Dreißig Kreise, Städte und Versorger haben ihre Bevölkerung für dieses Jahr schon aufgerufen, Wasser zu sparen. Wer seinen Rasen mehrmals zur Mittagszeit sprengt, dem drohen in Hannover bis zu 50.000 Euro Strafe. Einschränkungen für die Industrie gibt es bislang keine.
Die Recherche wurde unterstützt durch das Olin-Stipendium von Netzwerk Recherche e.V.

