„So oft es ging, war ich in den Achtzigerjahren mit dem Fahrrad vor den Toren Hamburgs unterwegs – morgens vor der Schule, nachmittags, am Wochenende. Ich habe damals für ,Jugend forscht‘ das Territorialverhalten von Mäusebussarden untersucht. Und stets wurden meine Expeditionen vom Gesang der Goldammer begleitet.
Das ist ein schmucker Vogel, ein Charaktervogel des norddeutschen Offenlandes. Während ich am Feldrand auf die Bussarde wartete, um sie zu fotografieren, saß oben im Gebüsch oft ein Männchen, warf seinen knallgelben Kopf in den Nacken und rief seine Strophe, dass es nur so durch die Landschaft schallte.
Man kann sich einen wärmeflimmernden Acker im Mai oder Juni ohne dieses tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsiiiiii kaum vorstellen.
Es gibt eine alte Übersetzung dieses Gesangs ins Deutsche: Wiewiewiewiewie hab ich dich liiiiiiieb.
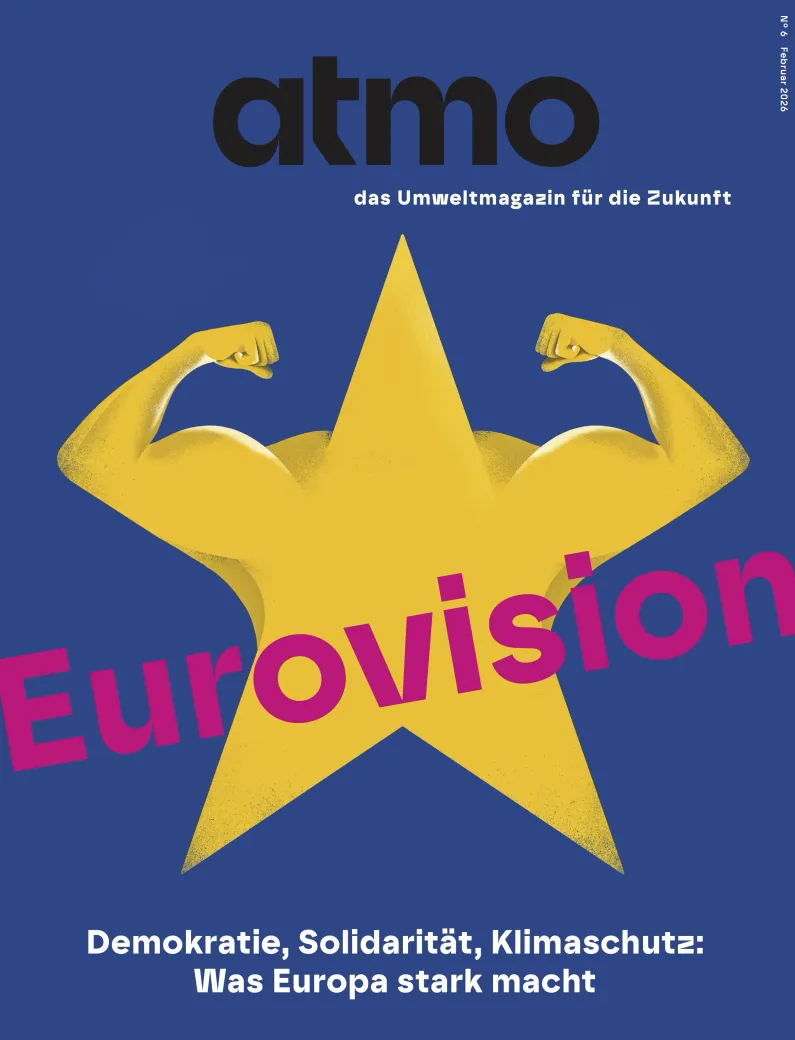
Dann abonniere unser Magazin gleich jetzt – gedruckt und als PDF.
Aber nicht jede Goldammer singt gleich, es gibt wie bei vielen Vogelarten regionale Dialekte. Schon in den Sechzigerjahren hat ein Kollege in der damaligen DDR eine Linie quer durch Mecklenburg beschrieben: Nördlich dieser Grenze sangen Goldammern anders als südlich davon. Seine Untersuchung endete aber nahe Lübeck zwangsläufig am Eisernen Vorhang.
Davon las ich, und so entschloss ich mich während des Studiums zu erkunden, wie sich die Linie im Westen fortsetzt. Ich lieh mir an meiner alten Schule von der Biologielehrerin ein Tonbandgerät aus und nutzte an der Uni einen Sonagrafen, ein Gerät, das dort niemand mehr brauchte. Damit konnte ich den Gesang der Goldammern auf einem speziellen Thermopapier sichtbar machen. Dann fuhr ich in Schleswig-Holstein und im südlichen Dänemark umher, und tatsächlich: Ich konnte zeigen, dass sich die Dialektgrenze von Mecklenburg entlang der Küste über die Ostsee bis an die Schlei fortsetzt. Die Ergebnisse habe ich mit Karten und Sonagrammen im ,Journal für Ornithologie‘ veröffentlicht und war natürlich sehr stolz.
Junge Ammern werden schon im Nest auf den Gesang ihrer Väter geprägt. Den Unterschied zwischen den Dialekten kann man leicht hören, vor allem der Schluss der Strophe ist im Norden anders als im Süden. So erhielt ich damals erste Einblicke in Mechanismen der Artbildung und der Evolution. Denn wenn die Unterschiede zwischen Dialekten größer werden, verstehen die Weibchen den Gesang der Männchen jenseits der Grenze irgendwann nicht mehr und paaren sich nicht mehr mit ihnen.
Später machte ich die Evolutionsbiologie und die Artenvielfalt zu meinen Forschungsschwerpunkten. Ich schrieb meine Diplomarbeit über Landschnecken, wurde Kurator der Molluskensammlung am Naturkundemuseum in Berlin, forschte in Australien, Indonesien und auf den Galapagosinseln.
Doch der biografische Zufall wollte es, dass ich Jahrzehnte später in die Region zurückkehrte, in der meine Forschung begonnen hatte. Ich wurde als Professor nach Hamburg berufen, um das dortige Naturkundemusum wieder aufzubauen, und wohne heute wieder in der Region zwischen Hamburg und Ahrensburg, in der ich groß geworden bin. Und was soll ich sagen? Wenn ich dort jetzt mit meinen Kindern Fahrrad fahre, höre ich kaum noch Goldammern.
Denn wie alle Feld- und Wiesenvögel bekommt sie sozusagen den Doppel-Wumms – durch das Ausräumen der Landschaft und durch Agrargifte wie Neonikotinoide. Zwar ernähren sich erwachsene Ammern von Samen, dennoch schlägt der zunehmende Insektenmangel voll auf sie durch, denn für die Aufzucht der Jungen brauchen auch Körnerfresser tierische Nahrung.
Ich lese viele Berichte über den globalen Biodiversitätsverlust und habe mehrere Bücher darüber geschrieben. Doch wenn eine Art verschwindet, die einst selbstverständlich zur Landschaft gehörte, in der man aufwuchs, geht einem das besonders nahe. Insofern verkörpert die Goldammer für mich dreierlei: die Schönheit der Natur, einen Teil der eigenen Biografie – und das Problem, das mich heute am häufigsten umtreibt: das stille Sterben der Natur.
Es wäre spannend zu untersuchen, ob sich die früher stabilen Dialektgrenzen inzwischen verschoben haben, wenn zum Beispiel Goldammern in leer gewordene Gebiete anderer Gruppen vorstoßen. Vielleicht finde ich ja irgendwann Zeit dafür.“
Protokoll: Wolfgang Hassenstein

