atmo: Kartoffelchips. Angenommen, wir vertilgen die jetzt und entsorgen die Tüte ordnungsgemäß – wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie recycelt wird?
Elena Schägg: Sehr gering. Die meisten Chipstüten sind innen mit Aluminium bedampft, um den Inhalt frisch und kross zu halten. Mal sehen...
Elena Schägg: Das zu recyceln, ist technisch sehr aufwendig.
Henning Wilts: Sieht nicht nach klassischer Bedampfung aus. Lose Lagen können in manchen Anlagen getrennt werden. Aber dort, wo zum Beispiel der Gelbe Sack aus unserem Institut in Wuppertal landet, würde die Tüte als Brennmaterial ins Zementwerk gehen.
atmo: Ist es nicht ohnehin aufwendig, Folien zu recyceln?
Schägg: Wenn Folien klein sind, etwa unter der Größe eines DIN A 4-Blattes, können Anlagen sie schwieriger sortieren und dann werden sie verbrannt.
atmo: Hier haben wir etwas Gesundes: Studentenfutter. Aber die Tüte ist klein und womöglich ein ähnlicher Fall wie bei den Chips?
Wilts: Nüsse und Trockenfrüchte sind ein klassisches Unverpackt-Thema. Sie könnten in Großbehältern angeliefert werden, im Supermarkt könnte man sich die gewünschte Portion abfüllen.
Schägg: Tatsächlich führt die Firma Seeberger in einigen Supermarktfilialen ein Pilotprojekt mit Mehrwegpfandbechern für Nüsse und Trockenfrüchte durch. Das wäre eine Lösung. Wichtig ist, dass eine solche Neuerung gut kommuniziert wird, damit die Mehrwegbehälter dann auch wirklich genutzt und wieder zurückgebracht werden.
atmo: In unserer Wahrnehmung sind die Unverpackt-Ecken in den Supermärkten in den vergangenen Jahren eher geschrumpft. Sie wirken lieblos behandelt, auch in manchen Biomärkten.
Wilts: Die Zahl der kleinen Unverpackt-Läden ist ebenfalls dramatisch gesunken.
Schägg: Rezessionsbedingt, würde ich sagen. Die Preise dort sind nicht immer wettbewerbsfähig. Deshalb brauchen wir Unverpackt-Angebote in jedem großen Supermarkt. Und hier könnte die EU-Verpackungsverordnung greifen. Sie hält Supermärkte ab einer bestimmten Größe dazu an, ab dem Jahr 2030 auf zehn Prozent ihrer Fläche unverpackte Produkte zum Abfüllen anzubieten, an Frischetheken etwa oder eben mit Abfüllstationen für Trockenware.
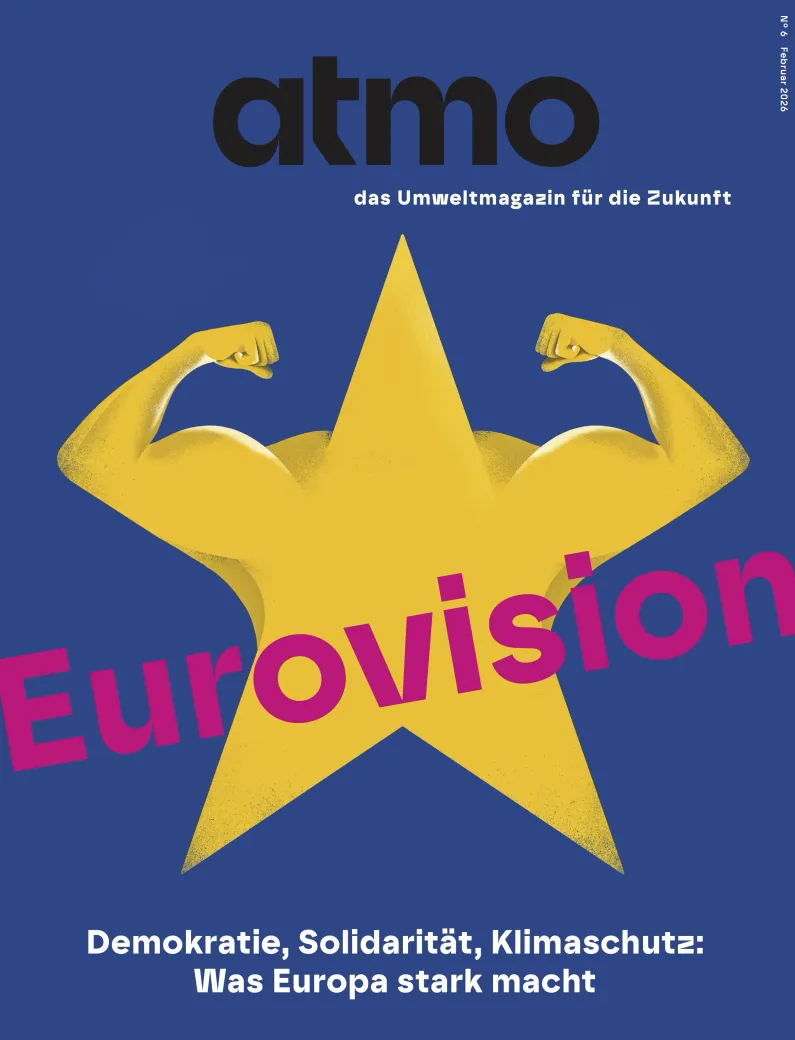
Dann abonniere unser Magazin gleich jetzt – gedruckt und als PDF.
atmo: Herr Wilts, wollen Sie uns mal ein Produkt vorstellen, dessen Verpackung Sie besonders überflüssig finden?
Wilts: Sehr ärgerlich ist das hier. Die Außenfolie wird nicht recycelt, die Döschen bestehen aus einer Materialkombination, von der wahrscheinlich allenfalls der Alu- oder Weißblechdeckel recycelt wird.
atmo: Könnte man so etwas nicht verbieten? Oder wäre das schon öko-diktatorisch?
Wilts: Es gibt so viele Möglichkeiten, Kaffeesahne besser einzupacken. Ich bin nicht unbedingt ein Verbotsfan, aber bei diesen Dingern …
Schägg: Tatsächlich werden ab 2030 einige Kleinstverpackungen, die man in der Gastronomie findet, verboten sein: Ketchup oder Mayonnaise. Aber das Verbot gilt nur für Kunststoff. Wir befürchten, dass die Industrie dann auf beschichtetes Papier ausweicht.
Wilts: Bei allen Verboten geht es darum: Wie kann ich sie so formulieren, dass die Hersteller nicht Schlupflöcher und Wege drum herum finden?
Schägg: Die EU hat zum Beispiel verordnet, dass ab 2030 Verpackungen bis zu einem gewissen Grad recyclingfähig sein müssen, ab 2035 dann auch im großen Maßstab tatsächlich recycelt werden. Bislang kann es vorkommen, dass das Recycling einer aufwendigen Verpackung zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis zu teuer ist. Zudem haben wir regional sehr unterschiedliche Anlagen. Was in Bayern aufbereitet werden kann, funktioniert in Berlin nicht unbedingt.
atmo: Auf vielen Verpackungen steht, dass sie zu x Prozent „recycelbar“ sind. Ist das denn gut? Was sagt mir das als Kunde?
Wilts: Das kann eine gute Orientierung sein, aber leider gibt es viele verschiedene Bewertungssysteme für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen – da kann es dann sein, dass ein- und dieselbe Verpackung mal als gut, mal als kaum recycelbar eingeschätzt wird.
Wilts: Ein Beispiel sind solche Sleeves – bedruckte Folienschläuche, die um die Flasche geschweißt wurden. Super nervig. Die boomen zurzeit, die finden Sie bei vielen Proteindrinks. Obwohl Folie und Flasche aus unterschiedlichen Plastikarten bestehen, gilt das Produkt als recyclingfähig, weil sich die Hülle theoretisch abziehen lässt. Nur: Welcher Verbraucher tut das?
atmo: So ähnlich wie bei Joghurtbechern mit Pappbanderole …
Schägg: … den sogenannten Drei-Komponenten-Bechern, genau. Solche Verpackungen wollen Verbraucher verpflichten mitzuarbeiten. Die sollen Metalldeckel und Banderole vom Plastikbecher entfernen, damit die Einzelteile recycelt werden können. Aber das machen längst nicht alle.
Wilts: Wo ist denn die Lasche zum Abziehen? Bei manchen findet man einen Hinweis: „Hier ziehen“. Aber bei dieser … Wenn die Manschette sich so schwer lösen lässt, ist die Chance gleich null, dass das recycelt wird. Die Anlage wird das Material nicht identifizieren können.
Schägg: In diesem Fall besonders dramatisch, denn Sleeves können das Recyclingmaterial von PET-Einwegflaschen verunreinigen, wenn die Flaschen eigentlich aus einem anderen Kunststoff wie Polystyrol bestehen. Weil sie bepfandet sind, werden sie in normale Leergutautomaten geworfen, wo sie in der Presse mit sortenreinen PET-Flaschen vermengt werden. Dabei klappt die PET-Wiederaufbereitung bisher noch am besten.
atmo: Besser als das Recycling mit Müll aus dem Gelben Sack?
Schägg: PET-Einwegflaschen werden durch das Pfand gesondert gesammelt, recycelt und wieder abgefüllt. So ist gewährleistet, dass sie nur mit Lebensmitteln, also Getränken, in Berührung kommen, und darum darf das Material auch weiterhin als Lebensmittelverpackung eingesetzt werden. Anders beim Müll aus der Gelben Tonne: Dort landen auch Dosen oder Kanister, die mit Ölen, Farbstoffen oder anderen Chemikalien in Verbindung waren. Das Gesetz verbietet, dass dieses Material nach dem Recycling für die Befüllung mit Lebensmitteln verwendet wird.
atmo: Was wir in die Gelbe Tonne werfen, ist also unbrauchbar für Lebensmittelverpackungen?
Wilts: Faktisch ist das so. Andernfalls müssten absurd aufwendige Nachweisverfahren durchgeführt werden, die belegen, dass die weggeworfenen Stücke keinen Kontakt mit Schadstoffen hatten. Teilweise fehlt es auch an Zulassungen für Recyclingverfahren, um dann wieder den Kontakt mit Lebensmitteln zu erlauben – obwohl diese Zulassungen schon vor Jahren beantragt wurden.
atmo: Laut Studien des Marktforschungsunternehmens Conversio und des Öko-Instituts wird mehr als die Hälfte dessen, was wir in die Gelbe Tonne werfen, thermisch verwertet, sprich: verbrannt. Nur ein gutes Drittel wird als Rohstoff für neue Produkte aufbereitet. Nun behaupten aber etliche Hersteller, ihre Produkte würden größtenteils recycelt – wie passt das zusammen?
Schägg: Das hängt damit zusammen, wie Recyclingquoten berechnet werden.
Schägg: Der Fachverband Kartonverpackungen sagt, dass mehr als siebzig Prozent der Getränkekartons recycelt würden. Auf dieses Ergebnis kommt er, indem er das Leergewicht aller verkauften Kartons mit dem Bruttogewicht jener Kartons vergleicht, die bei Recyclinganlagen angeliefert werden. Dabei schwappen in diesen noch häufig Getränkereste, sie sind verschmutzt oder mit anderen Abfällen verklebt. Wir haben nachgerechnet und dabei nicht geschaut, was angeliefert wird, sondern wie viel am Ende aus der Recyclinganlage herauskommt: nur gut ein Drittel.
atmo: Nur halb so viele Kartons werden recycelt wie behauptet?
Schägg: Ja. Während des Papierrecyclings entstehen hohe Faserverluste von rund zwanzig Prozent. Zudem wird rund ein Drittel der Kartons gar nicht im Gelben Sack entsorgt, sondern in den Rest- oder Papiermüll oder unterwegs weggeworfen.
Wilts: Man kann sich Ökobilanzen basteln, wie es einem in den Kram passt. Mit solchen Berechnungen haben die Hersteller durchgesetzt, dass im Verpackungsgesetz die Sonderkategorie der „ökologisch vorteilhaften Einwegverpackung“ geschaffen wurde. Und deshalb wurden die Getränkekartons nicht bepfandet. Für mich sind sie eine Sackgasse, ein Innovationshindernis. Die Kategorie gibt es inzwischen nicht mehr, aber bepfandet sind die Kartons immer noch nicht.
atmo: Apropos Milch. Wir haben hier eine sehr außergewöhnlich gestaltete Tüte. Der Inhalt stammt laut Aufschrift aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Und die Tüte soll zu vierzig Prozent aus Kreide bestehen. Das klingt natürlich irgendwie toll.
Schägg: In Wahrheit ist diese Tüte eine nicht recyclingfähige Einwegverpackung. Durch die Kreidebeimischung bekommt der Kunststoff eine Materialdichte, die die Messgeräte im Sortierwerk nicht erkennen. Die Tüte wird verbrannt.
atmo: Kommt das öfter vor, dass Hersteller sagen: „Wir sparen Plastik ein“, in Wirklichkeit aber die Verpackung nur verschlimmbessern?
Schägg: Ja. Wir beobachten zum Beispiel einen Zuwachs an Verpackungen, die auf den ersten Blick wie Papier aussehen, tatsächlich aber aus Verbundmaterial bestehen. Braunes Papier kommt bei Verbrauchern gut an: Sie glauben, es sei umweltfreundlicher als Plastik. Tatsächlich aber ist es oft mit Folie beschichtet, um es reißfester oder feuchtigkeitsabweisend zu machen. Berühmtes Beispiel sind Coffee-to-go-Becher, die kaum zu recyceln sind. Immer öfter werden neuerdings Kunststoffpolymere schon bei der Papierherstellung hinzugegeben – für fettabweisende Bäckereitüten etwa. So etwas lässt sich gar nicht gut recyceln.
Wilts: Wenn einzelne Unternehmen beschließen, werbewirksam zwanzig oder dreißig Prozent Plastik in ihrer Verpackung einzusparen, kann das ganz schnell zu schlecht designten Insellösungen und reinen Problemverschiebungen führen.
atmo: Wie kommen wir zu gut designten Großlösungen?
Wilts: Das Ziel sollten Mehrwegsysteme sein, die über Anreize funktionieren, zum Beispiel Pfand. Dabei ist zweitrangig, ob die Behältnisse aus Plastik oder Glas bestehen.
atmo: Das System der Gelben Tonne hat also ausgedient? Ist das, was wir Recycling nennen, eine Lüge?
Schägg: Wahr ist: Seit Gründung des Dualen Systems hat sich die Menge an Plastikverpackungsmüll verdoppelt. Es wird zwar ein großer Anteil an Verpackungen gesammelt, aus dem Material entstehen aber nicht wieder qualitativ gleichwertige Verpackungen. Deshalb ist immer wieder neues Plastik nötig, das vorwiegend aus Erdöl hergestellt wird.
atmo: Wie oft entsteht eigentlich aus recyceltem Plastik ein Produkt, dessen Material gleichwertig ist mit dem Vorgängerprodukt?
Schägg: Dazu gibt es meines Wissens keine Zahl für alle Plastikprodukte.
Wilts: Hinzu kommt: Die Angabe von Rezyklatanteilen ist oft Augenwischerei.
Wilts: Die sogenannte Multilayer-Folie oben drauf besteht aus sechs bis sieben Plastikschichten – unmöglich zu recyceln. Das Perfide daran: Einige Verpackungshersteller bieten ihren Kunden an, noch eine achte oder neunte Schicht aus Rezyklat hinzuzufügen. Bloß damit diese auf ihr Produkt schreiben können: Verpackung zu soundsoviel Prozent aus recyceltem Material. Faktisch entsteht nur noch mehr Müll.
atmo: Versuchen wir mal einen Überblick über unseren Einkauf. In Stichworten: Auf welche Einwegverpackungen könnte man verzichten, auf welche nicht? Wie würden die Produkte im idealen Supermarkt angeboten?
Schägg: Das französische Mineralwasser gäbe es gar nicht. Absurd weiter Transport, nicht zu rechtfertigen. Wenn Mineralwasser, dann regionales in PET- oder Glas-Mehrwegflaschen. Noch besser: Leitungswasser trinken. Babymöhren: superstabiles Gemüse, braucht keine Tüte. Champignons: Auch die sind einzeln verkaufbar – oder in Mehrwegschalen, in Belgien laufen Pilotversuche dazu. Orangen brauchen kein Plastiknetz mit breiter Banderole. Der Bundesverband Lebensmittelherstellung behauptet zwar: Verpackungen bewirken, dass weniger weggeworfen wird. Aus unserer Sicht kann es umgekehrt sein: Wenn in einem Netz auch nur eine Frucht schimmelt, wird der ganze Satz weggeworfen. Die Salamischeiben sind hübsch aufgefächert – brauchen deshalb viel Platz mit viel Folie. Haltbarer wären sie im Stapel. Idealerweise würde eine Wurst an der Frischetheke auf Wunsch geschnitten. Brombeeren – das wird schwierig. Da kommen wir um eine stabilisierende Schale kaum herum. Am besten in einem bepfandeten Mehrwegsystem. Sonst sollte sichergestellt werden, dass die Einwegschale aus recycelbarem Monomaterial ist. Insgesamt kann man sagen: Viel mehr Lebensmittel als wir oft meinen kann man ohne oder in Mehrwegverpackungen verkaufen. Man muss es nur wollen.
atmo: Kommen wir zur Eingangsfrage zurück: Was tun mit den Chips?
Wilts: Da sind Tüten wohl unverzichtbar. Unverpackt zum Abfüllen kann ich sie mir nicht vorstellen, sie müssen luftdicht eingeschlossen sein. Realistisch und vertretbar wäre aber eine Monomateriallösung aus klar identifizierbarem Kunststoff, die sich gut recyceln lässt, die dann zum Beispiel auch auf Bedruckungen verzichtet, die das Recycling erschweren.
atmo: Wie ließe sich der Weg zu einem System mit viel Unverpackt und Mehrweg, mit wenig Einweg und recycelbarem Plastik ebnen? Welche Instrumente halten Sie für wirksam?
Schägg: Ein guter Hebel für den Anfang wären Gebühren, die die Hersteller für die Entsorgung von Verpackungen zahlen. Die Herstellung von kurzlebigen nicht gut recyclingfähigen Verpackungen ist immer noch zu billig. Eine Ökomodulation mit Anreiz und Strafen würde das ändern: Niedrige Gebühren für gut recycelbare Produkte, hohe Gebühren für Verbund- und Mischmaterialien.
Wilts: Die Kosten für schlecht designte Verpackungen müssten dermaßen steigen, dass es schmerzt. In Frankreich gibt es für viele nicht recycelbare Einwegverpackungen hundert Prozent Strafaufschlag – damit rechnet sich der Umstieg auf ein Mehrwegsystem.

Henning Wilts
leitet die Abteilung Circular Economy am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und vertritt aktuell eine Professur an der Hafencity Universität Hamburg. Der Volkswirt erforscht den Umstieg von linearen auf zirkuläre Prozesse und koordiniert Forschungsprojekte zu kommunalen Zero-Waste-Strategien und zur Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Elena Schägg
ist Expertin für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie arbeitet zur europäischen und nationalen Verpackungspolitik mit dem Ziel, Mehrwegsysteme zu stärken. Zuvor war sie unter anderem als Abfallberaterin in Berliner Haushalten tätig. Sie hat an der Humboldt-Universität Ressourcenmanagement studiert.







